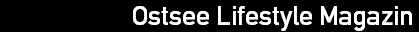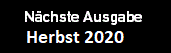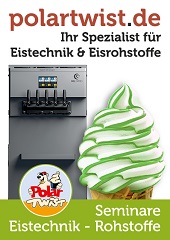Der ästhetische Wert ist eine messbare Qualität ...
Mit der "Living Bridge" kommt ein visionärer und noch zu realisierender Entwurf aus Ihrem Büro: Eine bewohnbare Brücke von beeindruckendem Format, welche zudem die Innenstadt Hamburgs mit einem derzeit noch isolierten Wohngebiet verbinden soll. Auf welche Weise bereichert eine solche Brücke die Wohn- und Lebenskultur?
Diese bewohnte und lebendige Brücke mit eintausend Wohnungen, aber auch allen Einrichtungen und Reizen eines eigenen Stadtteils auf dem Wasser wirkt für die Gesamtstadt auf mehreren Ebenen. Zum einen wird eine dringend benötigte Verkehrsverbindung für die Stadterweiterungsgebiete im Stromspaltungsgebiet der Elbe geschaffen. Diese großartige Raum- Reserve am Wasser ist der zweite, weit größere Schritt der wachsenden Stadt Hamburg nach der Hafencity. Der große Vorteil der "Living Bridge" liegt darin, dass nicht nur eine 700 Meter lange Straßenbrücke entsteht, die über eine solche Distanz gerade bei schwierigen Windverhältnissen für Fußgänger und Radfahrer nur sehr eingeschränkt nutzbar wäre. Die notwendige Verkehrsverbindung wird vielmehr dadurch erreicht, dass sich ein kompletter und lebendiger Stadtteil als Brücke über die Elbe hinweg entwickelt. Nur so entsteht eine intensive urbane Beziehung zwischen den alten und neuen Stadtbereichen, mit allen Reizen der Lage am Wasser und des Blicks auf die alte wie die neue Stadtsilhouette. Die europaweit einmalige Lagegunst Hamburgs wird architektonisch in einem ebenso einmaligen Stadterweiterungsprojekt umgesetzt.
Fotos: Hadi Teherani AGMan denkt bei dieser Idee zum Beispiel an die Brücke "Ponte Vecchio" in Florenz. Wie viele "lebendige" Brücken mag es schätzungsweise geben?
Die Bauaufgabe war historisch sehr verbreitet, man schätzte schon in den beengten Platzverhältnissen der mittelalterlichen Stadt den Flächengewinn und die damit realisierbare lückenlose Urbanität der Stadt. Konkrete Zahlen zu dieser Bauaufgabe sind aber schwer zu ermitteln. Denn es handelte sich dabei um eine ganz gewöhnliche, sehr alltägliche Bauform, die in den Quellen gar nicht als Besonderheit registriert wird. Ich schätze es gab mehrere Hundert Brücken dieser Art. Ein ähnliches Motiv, allerdings ohne Kontakt zum Wasser, sind die von Kleinindustrie und Gewerbe, heute auch von Kunstgalerien, Restaurants und Läden symbiotisch genutzten Viadukte des Eisenbahnverkehrs in den Städten. Hervorragend nutzbare Raumreserven, die mitten in der Stadt fast wie von selbst entstanden. Auch darüber ist sicher wenig statistisches Material verfügbar. Neue Projekte für belebte und bewohnte Brücken sind ebenfalls zahlreich nachzuweisen, für alle Metropolen dieser Welt, sogar für das hinsichtlich seiner Standorte am Wasser nicht unbedingt verwöhnte Berlin. Es fehlen allerdings die konkreten Umsetzungen. Insofern hat Hamburg die große Chance, sich nicht nur hinsichtlich von Dimension und Dramatik dieser Brücke sondern auch mit Blick auf den Zeitpunkt der Realisierung von den Konkurrenten abzusetzen.
Wie wichtig sind solche ambitionierten Projekte für die Stadtentwicklung?
Wie Paris immer wieder neu belegt, brauchen Metropolen beides. Die Kontinuität typologisch vergleichbarer Stadtbausteine, die sich nicht gegenseitig übertrumpfen, aber vor diesem homogenen Hintergrund auch die großartigen, einzigartigen Projekte - wie den Eiffelturm, die historischen, leider abgerissenen Markthallen, heute die großen Museen und Kultureinrichtungen. Denn diese Glanzpunkte der Stadt sind wichtige Elemente der Orientierung innerhalb der Metropole wie der Identifikation mit dem Gemeinwesen - in Städten, die immer glanzloser und belangloser ausufern.
Offensichtlich ist es so, dass der Mensch eine enge kulturelle Verbindung mit dem Wasser besitzt, die weit über den Aspekt des notwendigen Trinkens hinausgeht. Welche Erklärung dafür hat Sie am meisten überzeugt?
Das Wasser ist der Ursprung des Lebens, es verkörpert die Naturgewalten am anschaulichsten. Das Meer ist ein hochdynamisches Element, vergleichbar nur mit dem Feuer, das in seiner Erscheinungsform ebenfalls keine Wiederholung zulässt. Jede Welle, jedes Geräusch, jeder Morgennebel, jede Lichtreflexion erscheint nur einmal, für einen kurzen Moment, dann nie wieder in identischer Form.
Welche Ideen kommen Ihnen in den Sinn, wenn Sie sich Gedanken machen über mögliche Hotel- und Wohnarchitektur an der mecklenburgischen Ostseeküste?
Es sind immer zwei Ebenen, die sich in der Stadtentwicklung anbieten. Historische Bauten müssen in ihrem Charakter trotz notwendiger Umnutzungen unbedingt erhalten werden. Direkte Erweiterungen von denkmalwürdigen Bau-ten wie auch eigenständige Neubauten dürfen diese historischen Vorgaben aber nicht als Verfügungsmasse für banale Nachschöpfungen missbrauchen, die so tun, als seien sie genauso alt und authentisch. Das ist Geschichtsklitterung. Der Wert eines historischen Gebäudes wird im Kontrast zur Moderne sichtbar und anschaulich, nicht durch schlecht gemachte Kopien. Die große Aufgabe neuer Architektur besteht also darin, den Charakter einer Stadt oder Landschaft aufzugreifen und umzusetzen, nicht einzelne Formelemente, die billig nachzumachen sind. Die Ostseeküste hat eine große Zukunft vor sich. Architektonisch ist davon noch nicht allzuviel sichtbar.
Hatten Sie schon Gelegenheit diesen Landstrich kennen zu lernen?
Ja, natürlich. Rügen kenne ich, den Darßer Weststrand, Rostock, Heiligendamm, Warnemünde samt dem Hinterland bis Tangermünde. Die Tourismuszahlen explodieren geradezu. Damit besteht die Gefahr, dass zu schnell und zu unüberlegt für eine Nachfrage gebaut wird, die sich dann vielleicht, wenn der architektonische Schaden angerichtet ist, schnell wieder abkühlt. Die Ostseeküste Schleswig- Holsteins bietet einige Negativ - Beispiele dieser Art. Gerade in einzigartigen Landschaften müssen Kontrollinstrumente greifen, die über das Absegnen von potentiellen Arbeitsplätzen hinausgehen.
Wenn Sie kühn 40 Jahre weiter denken: Wie leben wir im Jahr 2050 mit dem und am Wasser? Welche Häusertypen erblicken wir dann? Welche Materialien werden eingesetzt?
Das ist sicher eine ebenso beliebte wie schwierige Frage. Wir müssen zu störungsfreien urbanen Verdichtungsmodellen mit einfamilienhausähnlichen Qualitäten kommen, die der Landschaft ihren Charakter und Freiraum lassen. Das Zersiedeln der Landschaft muss gestoppt werden. Wir brauchen klare Ortsbilder in Abgrenzung zur Landschaft, gerade in den bevorzugten Uferlagen. Ökologisch und energetisch wird der bauliche und technische Fortschritt sicher besonders groß ausfallen. Architektonisch nur dann, wenn Bauherren, Investoren, Städte und Gemeinden diesen ästhetischen und atmosphärischen Wert - übrigens eine sehr wohl messbare Qualität im Gebäude wie außerhalb - hartnäckig einfordern. Verschiedene europäische Nachbarländer sind auf der Nachfrageseite deutlich weiter als Deutschland, das sich in schöner Regelmäßigkeit mit seinen Expo- Bauten blamiert. Ich sehe die Zukunft nach wie vor in weiten, bewegten, lichten Räumen, in Transparenz, anschaulicher Struktur, in der Wechselbeziehung von Innenraum und Außenraum, wie sie schon immer ein Traum der Menschheit war, vom antiken Rom über die kühnen Glasfronten der Neuzeit bis zu Mies van der Rohe.
Interview: Ricky Laatz